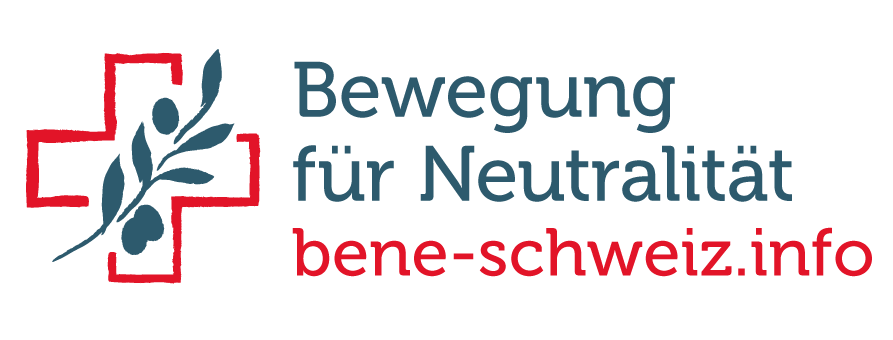Von René Roca*
I. Der Sonderbund von 1845 und seine Vorgeschichte
Viele Historiker und Juristen, die einen EU- und Nato-Beitritt der Schweiz befürworten, geben jeweils die Vorgeschichte des Sonderbundes ab 1815, also vor allem Restauration und Regeneration in der Schweiz, verkürzt wieder und ignorieren dabei den historischen Forschungsstand dieser wichtigen Phase der Schweizer Geschichte.
Sie folgen dabei der eindimensionalen liberalen «Meistererzählung», welche den Freisinn als einzigen Träger des Fortschritts bezeichnet und die Katholisch-Konservativen in «ständestaatlicher Ordnung» verhaftet sieht und als Bremsklotz für die Moderne.
Die Phase von 1798 bis 1848, also von der Helvetik bis zur Gründung des Bundesstaates, war für die Schweiz eine Phase der politischen Umbrüche, ohne Schwarz und Weiss, dafür mit vielen Grautönen. Ein Höhepunkt war der Sonderbundskrieg 1847.
Der 1845 gegründete «Sonderbund» resp. die «Schutzvereinigung» verstiess wie das liberale Siebnerkonkordat vom März 1832 und der konservative Sarnerbund vom November 1832 gegen die Bestimmungen des Bundesvertrags von 1815.
Eklatante Rechtsverletzungen wie die Klosteraufhebungen und Freischarenzüge sowie die Untätigkeit der Tagsatzung machen seinen Gründungsakt verständlich. Gewissen Liberal-Radikalen kam der Sonderbund (wie die Jesuitenfrage) entgegen, weil sie davon ausgingen, dass ohne Gewalt eine Umgestaltung der Schweiz kaum durchführbar sei.
Deshalb trieben sie den Konflikt propagandistisch bis zum Krieg weiter, der glücklicherweise auch dank der Zurückhaltung der Kantone und dem General der Tagsatzungstruppen, Guillaume Henri Dufour, nur ein «Bruderzwist» blieb.
Die Anhänger des Sonderbunds ihrerseits manövrierten sich ins Abseits und verschärften die Konfessionalisierung derart, dass sich unter anderem die reformierten Konservativen, die den politischen Anliegen des Sonderbunds wohl gesonnen waren, abwandten oder neutral verhielten.
Da die Bevölkerung der Sonderbundskantone mehrheitlich einen Offensivkrieg über die Kantonsgrenze hinaus ablehnte, die militärische Führung nicht genügte und Absprachen untereinander fehlten, blieben die Aktionen des Sonderbunds zum Scheitern verurteilt.
Die Bewertung der Vorgeschichte des Sonderbundes ist zentral und wird in der Regel zu wenig gewichtet. Viele Historiker und Juristen verharren hier in alten Mustern, dabei war diese Phase eine entscheidende Grundlage für den späteren Bundesstaat.
Der Freiburger Historiker Oskar Vasella konstatiert diesbezüglich, dass gerade in der Beurteilung des katholischen Konservatismus «eine grössere Freiheit im geschichtlichen Denken» nötig sei, um die Vorgeschichte der Bundesstaatsgründung wahrheitsgetreuer darzustellen.
Die eidgenössischen Kantone stellten bereits während der Restaurationszeit «Laboratorien der Freiheit» dar, was schliesslich auch zur Entwicklung der Demokratie auf Gemeinde- und Kantonsebene beitrug.
Das führte dann in der Phase der Regeneration ab 1830 dazu, dass neben radikalen und frühsozialistischen Kreisen auch die Katholisch-Konservativen in ihren Kantonen mehr Volksrechte erkämpften, so zum Beispiel im Kanton Luzern, wo nach St. Gallen und Baselland demokratisch-konservative Kreise das Gesetzesveto als Vorläufer des fakultativen Referendums einführten. Im Gegensatz zu heute gängigen Behauptungen haben die Katholisch-Konservativen am Erfolgsmodell der Schweiz entscheidenden Anteil.
Die Bundesverfassung von 1848 war die erste Verfassung der Eidgenossenschaft, die sich die Schweizer Stimmberechtigten selbst gaben. Die Schweiz wurde damit für die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts eine demokratisch-republikanische Insel inmitten der Monarchien Europas. Im übertragenen Sinne sind hier Vergleiche mit der Gegenwart durchaus erwünscht.
Der Sonderbund half indirekt mit, eine zentralistische Lösung zu erschweren und weitere revolutionäre Umgestaltungen im Sinn der Radikalen zu unterbinden. Dazu schreibt Vasella:
«Vielleicht sind die Geister doch erst durch den Bürgerkrieg, den niemand wünscht und niemand preist, zur Besinnung auf das Recht gekommen, vielleicht ist doch erst durch den jahrelangen Widerstand der Konservativen und durch den Sonderbundskrieg die revolutionäre Welle gebrochen worden. Die Bundesverfassung von 1848 hat das Ständeprinzip gerettet, damit auch den Gedanken des Ausgleichs zwischen den kleinen und grossen Ständen bewahrt.»
In den nächsten Jahrzehnten standen dann im Zeichen der Konkordanz der weitere Ausgleich und die Integration der Verlierer und nicht Siegerdiktat und Ausgrenzung im Vordergrund.
Im Gegensatz zu Thomas Cottier in seinem Beitrag «Der neue Sonderbund» ordnet Alt-Bundesrat Alain Berset (SP) den Beitrag der Katholisch-Konservativen für die eidgenössische Bundesverfassung historisch korrekt ein:
«Nach dem Sonderbundskrieg haben die Kantone, die gesiegt haben, nicht einfach eine neue Verfassung geschrieben und sie den katholischen Kantonen aufgezwungen. Sie haben es zusammen mit ihnen gemacht. Und einen souveränen Staat geschaffen, der auf Augenhöhe mit den Mächten Europas war.»
Das war ein «historischen Verfassungskompromiss», der in den anderen europäischen Staaten nicht gelang.
II. Parallelen zur Gegenwart – Zeit, den demokratisch verfassten Nationalstaat zu stärken
Die meisten EU- und Nato-Befürworter behaupten, dass die heutige Debatte um die Integration der Schweiz in die EU und Nato wichtige Parallelen zur Gründungszeit des Bundesstaates von 1848 aufweise. Tatsächlich geht es im Kern um die Frage der Souveränität.
Die Beitrittsbefürworter betonen in diesem Zusammenhang, auch die schweizerischen Kantone hätten ja damals Souveränität an den Bund abgegeben und einen solchen Schritt müsste nun auch die Schweiz in Richtung EU machen.
Zum einen wird damit suggeriert, die EU befinde sich mit dem angestrebten Ziel eines europäischen Bundesstaates auf einer Erfolgsstrasse, zum anderen wird der Schweiz eingeredet, dass sie mit einem EU-Beitritt genau das vollziehen würde, was sie in ihrer Geschichte schon einmal gemacht habe, nur dieses Mal eben im grösseren Rahmen.
Wer solches nicht unterstützt, wird in der Regel pauschal des «Konservatismus» bezichtigt. Thomas Cottier, ein eigentlicher EU- und Nato-Turbo, behauptet sogar, diese Kritiker würden heute einen «neuen Sonderbund» bilden. So ein historischer Vergleich hinkt beträchtlich und führt ins ideologische Abseits.
Wie sieht denn heute das EU-Gebilde aus? Cottier spricht bezüglich der EU von einem «neuen Bund in Europa» und dann gar von einem «föderalen Bund». Die EU ist aber de facto weder ein Staatenbund noch ein Bund von gleichberechtigten Ländern. Sie ist keine Nation, sondern ein zentralistisches Gebilde (Brüssel), das durch verschiedene Vertragswerke zusammengehalten wird.
An die diversen Verträge halten sich die einzelnen Länder nur bedingt (vgl. Maastricht-Kriterien). Der Hang der EU zu einem bürokratischen Moloch ist augenfällig. Seit den Anfängen, also seit der Montanunion 1951, zeichnet sich die EG/EU zudem durch das Konzept der Supranationalität aus. Das heisst, dass die einzelnen Mitgliedsländer immer mehr souveräne Rechte an das Zentrum abtreten und die eigene staatliche Souveränität kontinuierlich entleert wird.
In den einzelnen Ländern der EU sind – ausser in Irland – nicht einmal Volksabstimmungen für die Staatsverträge, welche die rechtliche Grundlage bilden, vorgesehen. Föderal aufgebaut, wie Cottier behauptet, ist die EU auch nicht und selbst die auf Eis gelegte EU-Bundesverfassung, die grösstenteils mit dem Vertrag von Lissabon von 2007 eingeführt wurde, enthält keine klassischen föderalen Elemente.
Dementsprechend hat auch das ständige Reden der EU-Verantwortlichen von Subsidiarität keinen Bezug zur Realität. Cottiers Behauptung, die heutigen Strukturen der EU – «ein System der Mehrebenenregierung» – seien mit der schweizerischen Bundesverfassung kompatibel, ist absurd.
III. Die Würdigung des Schweizer Sonderwegs
Cottier und andere reden auch eine «globale Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autokratie» herbei. Eine solche Dichotomie ist unsinnig, schaut man sich nur den Zustand der Demokratie in Europa an.
Die beiden «Kernländer» der EU, Frankreich und Deutschland, versinken immer mehr in Wirtschaftskrise und politischem Chaos. Frankreich wird von einem autokratischen «Ersatz-Kaiser» präsidiert, das Parlament verharrt in Flügelkämpfen ohne Bereitschaft für Kompromisse.
In Deutschland regiert schon länger eine Partei-Diktatur, welche liberale und demokratische Grundsätze immer mehr schleift, und dafür «Brandmauern» errichtet.
In Zeiten, in der in Europa Intellektuelle wie Cottier das postnationale resp. das postdemokratische Zeitalter einläuten wollen, ist es an der Zeit, den demokratisch verfassten Nationalstaat zu festigen und diesen als Rechtsstaat weiter zu stärken.
Nur so können Friede und Ordnung gesichert werden. Den Nationalstaat in Europa zu festigen, würde auch heissen, das Projekt der Aufklärung zu vollenden und endlich als ein «Europa der Nationalstaaten» den Status eines US-Vasallen abzuschütteln.
Die neutrale Schweiz muss solches konsequent unterstützen. Sie muss ihren Sonderweg mit der Neutralität als Fundament des Friedens weiter gehen und wird so immer mehr zum demokratischen Modell in einer zunehmend zerrütteten Welt. Die Eidgenossenschaft vereint die besten europäischen Traditionen und könnte mithelfen im Dialog eine europäische Sicherheitsarchitektur zu errichten, einfach ohne die Nato.
*René Roca ist promovierter Historiker, Gymnasiallehrer und leitet das Forschungsinstitut direkte Demokratie. Roca ist der geistige Vater der Neutralitätsinitiative, im Komitee der Initiative und im Vorstand der Bewegung für Neutralität