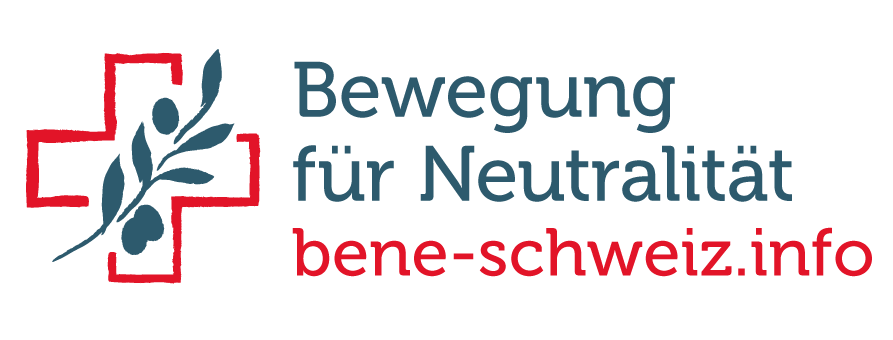Um die Schweizer Rüstungsindustrie vor dem wirtschaftlichen Verfall zu bewahren, soll das Kriegsmaterialgesetz geändert werden. Sicherheitspolitiker im Ständerat fordern eine Lockerung der Exportbeschränkungen, um auch Staaten beliefern zu können, die sich in bewaffneten Konflikten befinden. Die Idee widerspricht dem Neutralitätsrecht.
Die Schweizer Rüstungsindustrie steht unter Druck: Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine meiden viele europäische Staaten – insbesondere Nato- und EU-Mitglieder – den Kauf von Schweizer Rüstungsgütern, wie die Neue Züricher Zeitung, (NZZ) am Mittwoch schrieb. Der Grund ist das in der Schweiz geltende Kriegsmaterialgesetz, das den Export von Waffen an Länder einschränkt, die sich in einem bewaffneten Konflikt befinden.
Sollte beispielsweise ein Nato-Land in einen Krieg verwickelt werden, könnte die Schweiz aufgrund ihrer Neutralitätspolitik keine Waffen mehr an das betreffende Land liefern. Dies hat dazu geführt, dass einige Staaten wie die Niederlande, Spanien und Dänemark auf Schweizer Rüstungsgüter verzichten. Deutschland geht sogar so weit, dass es mittlerweile auch keine Lieferungen mehr für Tarnnetze aus der Schweiz akzeptiert, obwohl die EU ihre Verteidigungsausgaben massiv steigern will.
Für die Schweizer Rüstungsindustrie, die ohnehin mit einer Auftragsflaute zu kämpfen hat, sind diese Entwicklungen ein schwerer Schlag. Die Exporte sind 2024 um fast 5 Prozent gesunken, und die Branche sieht sich angesichts der geopolitischen Unsicherheiten zunehmend in ihrer Existenz bedroht. Besonders die Tatsache, dass fast alle Schweizer Waffenexporte in die NATO-Staaten fliessen, verstärkt das Risiko eines wirtschaftlichen Einbruchs, falls die derzeitigen Exportbedingungen nicht geändert werden.
In diesem Kontext hat die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SiK-S) nun einen weitreichenden Vorschlag zur Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes vorgelegt. Der Vorschlag zielt darauf ab, Partnerländer auch dann mit Rüstungsgütern beliefern zu können, wenn diese in einen internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt sind – es sei denn, es liegen «ausserordentliche Umstände» vor, die dem Export entgegenstehen. Dies könnte vor allem in Fällen eines NATO-Bündnisfalls relevant werden, in dem sämtliche Nato-Staaten im Krieg agieren. Der Bundesrat, die Schweizer Landesregierung, behielte dabei ein Vetorecht.
Die Initiative wurde von der Mitte-Ständerätin Brigitte Häberli-Koller eingebracht, die einen klaren wirtschaftlichen Impuls geben möchte:
«Die Schweiz kann über kurz oder lang keine Rüstungsgüter mehr selber herstellen – auch nicht für die eigene Armee, der Heimmarkt ist zu klein“» betont Häberli-Koller.
Ihre Argumentation fand bei den meisten Kommissionsmitgliedern Gehör – der Vorschlag wurde mit 8 zu 3 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen.
Die Rüstungsindustrie reagierte erleichtert auf den Vorstoss. Der Arbeitskreis Sicherheit und Wirtschaft, die Lobbyorganisation der Branche, bezeichnete die Änderung als «zwingende Voraussetzung» zur Vermeidung eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Der derzeitige Zustand der Exportrestriktionen könnte die gesamte Kundschaft der Schweizer Rüstungsindustrie verlieren, falls es zu einem Nato-Konflikt kommt. Allein 2023 gingen 84 Prozent der Exporte in Nato-Staaten, 2024 waren es sogar 92 Prozent.
Der erste Rat, der sich mit der Änderung beschäftigen wird, ist der Ständerat, voraussichtlich in der Sommersession dieses Jahres. Es bleibt abzuwarten, ob auch der Nationalrat der Lockerung zustimmt und die Rüstungsindustrie damit eine aus ihrer Sicht dringend benötigte Perspektive erhält.
Bemerkenswert an diesem Vorstoss und an der Berichterstattung ist nicht nur die Tatsache, dass er überhaupt lanciert wurde, sondern dass die Neutralität nur am Vorbeigehen erwähnt und als Hindernis gesehen wird.
Blenden wir zurück, um das Ganze in einen historischen Kontext zu stellen. Als im Jahr 1940 Frankreich vor Deutschland kapitulierte, war die Schweiz durch die Achsenmächte praktisch eingeschlossen. Es gab bei Genf zwar noch eine einspurige Eisenbahnlinie ins unbesetzte Frankreich, aber im Prinzip konnten die Achsenmächte die Schweiz wirtschaftlich strangulieren.
Durch einen Kohleboykott liessen die Nazis im Juni 1940 ihre Muskeln spielen. Es kam dann zu Wirtschaftsverhandlungen. Bundesrat Walther Stampfli, konnte aber auch einige Trümpfe in die Waagschale werfen. Die Schweiz hatte einen funktionierenden, internationalen Finanzplatz, intakte Produktionskapazitäten, das Land war neutral und konnte vermitteln und es verfügte über leistungsfähige Alpentransversale, die es aber bei Bedarf sperren oder sprengen könnte.
Die Lösung: Deutschland lieferte wieder Kohle, Eisen und Erdöl und verpflichtete sich, den Handel der Schweiz mit den Alliierten zuzulassen, die Schweiz lieferte weiterhin verarbeitete Industrieprodukte – auch Waffen! – und garantierte die Offenhaltung der Alpentransversalen. Die Schweiz verpflichtete sich, an die Alliierten keine Waffen zu liefern (was sie dann in beschränktem Umfang und im Geheimen gleichwohl tat).
Das Ergebnis ist ein klassischer Kompromiss, der in hartem Ringen zustande kam. Jede Forderung Deutschlands konterte Stampfli mit einer Gegenforderung. Es ist aktenkundig, dass Stampfli die deutsche Delegation zu sich rief, wenn es nicht vorwärts ging und man seine Stimme auch durch verschlossene Türen hörte.
Es ist richtig, dass die Schweiz das Neutralitätsreicht damit verletzte. Sie lieferte an Kriegführende und verpflichtete sich, die gleiche Dienstleistung der anderen Seite vorzuenthalten. Allerdings handelte sie dabei aus purer Not. Die Alternative wäre eine völlige wirtschaftliche Abschnürung gewesen. Gerade Stampfli befürchtete für diesen Fall Unruhen und die Möglichkeit, dass die Schweizer Bevölkerung, die den Nazis überwiegend ablehnend gegenüberstand, dann einknickte. Man kann deshalb verstehen, dass Stampfli so gehandelt hat. Im November 1940 schrieb er:
«Immer mehr scheinen jene recht zu bekommen, die vorausgesagt haben, dass es am Ende dieses Krieges keine Neutralen mehr gibt. Schon jetzt darf man in den Besprechungen mit Deutschland auf die Pflichten der Neutralität gar nicht mehr hinweisen, weil man sich schon damit dem Vorwurf der Englandhörigkeit aussetzt. Diese Gratwanderung zwischen zwei Abgründen wird für den Bundesrat immer mehr zu einem tödlichen Sporte, der auf die Initiative lähmend wirkt.»
Heute ist die Situation anders. Es besteht keine Notwendigkeit, das Kriegsmaterialgesetz zu ändern. Es mag Druck aus dem Ausland geben, aber es drohen nicht die Gefahren, die 1940 drohten. Dass die Rüstungsindustrie eine Liberalisierung befürwortet, kann man verstehen, aber der Bundesrat muss im Landesinteressen handeln.
Es wird interessant sein, zu beobachten, wie sich der neue Verteidigungsminister, Bundesrat Martin Pfister in dieser Sache positioniert. Er täte gut daran, sich für die Neutralität einzusetzen und damit für eine Ablehnung der Vorlage. Erst wenn die Schweiz wieder als neutral wahrgenommen wird, kann sie wieder zur Vermittlungsplattform werden und ihre guten Dienste anbieten.
Es geht nicht darum, eine egoistische Form der Neutralität zu propagieren, sondern eine der Welt zugewandte Form, bei der die Schweiz nicht nur ein Anhängsel der NATO ist, sondern eine eigene, positive Rolle spielt. Gerade linksgrüne Kreise haben sich aus einer verantwortungsethischen Haltung heraus in der Nachkriegszeit für strikte Kriegsmaterialgesetze eingesetzt. Sie dem Februar 2022 haben sie nichts mehr gegen die Lockerung derselben. Von Neutralitätsrecht, Neutralitätspolitik und der Geschichte der Schweizer Neutralität scheinen sie nicht viel zu verstehen.